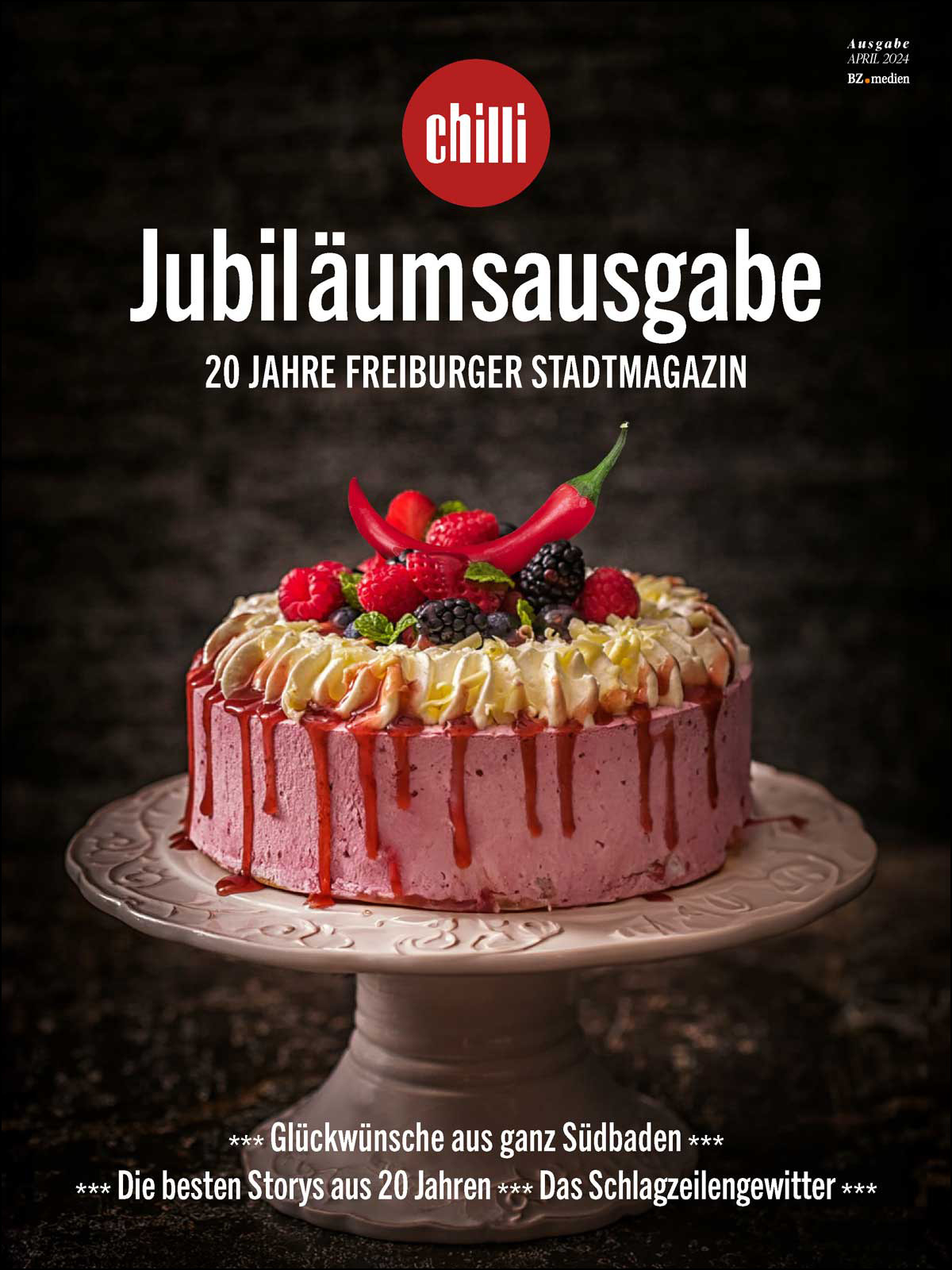Frei. Luft. Kunst – Freiluftausstellungen Kunst & Kultur | 12.04.2025 | Marianne Ambs, Erika Weisser, Beat Eglin

Glänzende Stahlskulpturen, witzige Betongesichter, bunte Wegmarken, tanzende Bronzefiguren: Der Frühling ist die beste Zeit für Kunstspaziergänge unter freiem Himmel. Vier besondere Touren in der REGIO stellen wir vor. Sie alle versprechen Entspannung, Entschleunigung und intensive Kunst-Begegnungen in der Stadt oder in der Natur.
Foto: © Oliver Welti
Kunstweg Erich Hauser
Schramberg

Erich Hauser hat in Schramberg Spuren hinterlassen: Das Wandrelief aus Nitrostahl stammt aus der Werkphase in den 80er-Jahren.
Auf der Suche nach dem Ausdruck
Seine oft raumgreifenden stählernen Skulpturen bohren sich in den Himmel, winden sich in glänzenden Strängen am Boden oder setzen kleinformatige filigrane Akzente. Deutschlandweit finden sich mehr als 160 seiner Werke auf öffentlichen Plätzen, vor Behörden, Schulen oder Museen. Wie kaum ein anderer hat Erich Hauser (1930–2004) mit seiner Kunst im öffentlichen Raum Stadtlandschaften geprägt – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Im nordöstlichen Schwarzwald ist seine Kunst besonders präsent. Vor allem in Rottweil, wo Erich Hauser ab 1970 lebte und arbeitete, können Kunstfreunde den Werken des documenta-Teilnehmers und Biennale-Gewinners begegnen. Hier gründete Hauser selbst 1996 eine Kunststiftung und machte sein fast fünf Fußballfelder großes Kunst-, Arbeits- und Wohnareal samt Skulpturenpark zu einem Ort der Kunstbegegnung. An Samstagen ist der Park für Besucher frei zugänglich (15–17 Uhr), Führungen an jedem letzten Sonntag des Monats vermitteln vertiefte Einblicke.
Erich Hauser, 1930 in einem kleinen Dorf bei Spaichingen geboren, stammte aus einfachen Verhältnissen. Nach einer Ausbildung als Stahlgraveur widmete er sich seiner künstlerischen Laufbahn. Im Wesentlichen war er aber Autodidakt, eine akademische Kunstausbildung blieb ihm verwehrt. In den ersten Jahren als freischaffender Bildhauer lebte er von 1952 bis 1959 in Schramberg, experimentierte mit verschiedenen Techniken und Materialien. Ein Kunstweg in der Schramberger Talstadt zeichnet mit fünf Stationen die frühe Schaffensperiode von Erich Hauser nach.
Der Weg durch die Altstadt beginnt beim Josefsbrunnen am Doblerplatz mit der Sandsteinfigur des Heiligen Josef. Die Restaurierung der Figur war Hausers erste Auftragsarbeit für die Stadt Schramberg. Weiter geht es zum Findlingsbrunnen am Paradiesplatz. Wasser sprudelt aus dem größten der Findlinge und ergießt sich über den Stein. Das Ensemble aus Granitfindlingen hat Erich Hauser 1972 gestaltet, als er schon für seine Stahlplastiken bekannt war. Typisch für Hausers Stahlplastiken aus den 90er-Jahren ist die Skulptur 9/9 vor dem Schramberger Schloss. Stahlspitzen recken sich dem Himmel entgegen. Die geometrisch zusammengefügten Flächen fangen die Sonne ein. Ein Zeugnis verschiedener Schaffensperioden ist die St. Maria Kirche: Hier hat Erich Hauser in seinen Schramberger Jahren die Eingangstüren entworfen. 34 Jahre später beauftragte man den Künstler, im Zuge der Renovierung der Kirche das Kircheninnere zu gestalten – von den Fenstern, über das Altarkruzifix und weitere sakrale Gegenstände bis zu den Bodeneinlegearbeiten. Nach einem Spaziergang durch die Altstadt und einem italienischen Eis endet der Kunstweg mit der Plastik „Relief 9/84“ an der Fassade des Volksbank-Hochhauses. Das Wandrelief hat Hauser 1984 für die Volksbank Schramberg aus Nitrostahl gefertigt. Es ist mit seinen aufbrechenden Kreisformen typisch für Hausers Werkphase der 80er-Jahre.
Weitere Informationen zum Kunstweg in Schramberg und zur Kunststiftung Erich Hauser unter www.erichhauser.de
Foto: © Marianne Ambs
Kunstparcours
Freiburg

Schauen, schmunzeln, nachdenken: Gartenschlauch im Eschholzpark
Kunstreicher Stadt-Spaziergang
Wer mit offenen Augen des Wegs geht, wird in Freiburg jede Menge Kunstwerke entdecken, die öffentliche Räume beleben. Auf Plätzen, in Parks, auf und unter Brücken, vor oder in allgemein zugänglichen Gebäuden stehen oder liegen sie, bereichern ihre Standorte und deren Umgebung mit ganz neuen Aspekten und Perspektiven, regen an zum Innehalten und Nachdenken.
Wer etwa von der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in östlicher Richtung wandert, wird erstaunt sein über die vielen und vielfältigen plastischen Werke aus der Hand verschiedener Künstler. So ist gleich im Innenhof des Berufsschulzentrums eine architektonische Arbeit von Richard Schindler anzutreffen. „Haltestelle“ heißt das begehbare Gebilde, das an einen Wartesaal erinnert. Es ist Gertrud Luckner gewidmet, die in der Nazizeit für ihren auf die Rettung verfolgter Menschen zielenden Widerstand oft in Zügen und auf Bahnhöfen unterwegs war – und dort auch verhaftet wurde.
Von hier ist es nicht weit zum Eschholzpark, wo eine vom Künstlerpaar Claes Oldenburg und Coosje van Bruggen geschaffene Großskulptur in den Himmel ragt: ein 10 Meter hoher und 84 Meter langer roter Gartenschlauch mit Wasserhahn. Er soll daran erinnern, dass hier bis in die 1970er-Jahre eine Kleingartenanlage existierte. Um Wasser geht es auch bei der Figurengruppe „Schlucker und Spucker“ von Franz Gutmann. Seit 1982 lagern diese beiden Riesen, von denen nur Köpfe, Hände und Füße zu sehen sind, unter der Stadtbahnbrücke beim Stühlinger Kirchplatz. Sie sind durch ein Freiburger Bächle verbunden, das vom Spucker gespeist wird und in den Schlund des Schluckers strömt.
Vom Park aus geht es zur Wiwili-Brücke, die zu Andrea Zumseils „Tanzenden Kegeln“ vor dem Konzerthaus führt. Kurz vor dem Ende der Brücke kommt auf der rechtsseitigen Mauer ein Gegenstand in den Blick, der wie eine in Eile zurückgelassene Jacke wirkt. Diese eher unscheinbare Bronzeplastik von Birgit Strauch erinnert seit 2003 an die im Oktober 1940 erfolgte Deportation Freiburger Jüdinnen und Juden in das Lager Gurs.
Die beiden nächsten Stationen auf dem west-östlichen Kunstparcours sind nicht jederzeit zu bewundern: Das Treppenhaus zwischen KG I und KG III der Universität Freiburg, das seit 1996 Bettina Eichins eigentümliche „Neun Musen“ beherbergt, ist an Wochenenden und nachts geschlossen. Dasselbe gilt für den Zugang zum Gelände der Alten Uni und zum Literaturhaus, wo ein riesiges Wandmosaik von Julius Bissier und Richard Bampi auf Besucher wartet. Rund um die Uhr wird hingegen Ole Meineckes steinernes Krokodil an der nahe gelegenen malerischen Insel in der Altstadt vom Wasser des Gewerbebachs umspült.
Foto: © Erika Weisser
Rehberger-Weg
Riehen & Weil am Rhein

„Baum“ vor Bäumen: Objekt 19 auf dem Rehberger-Weg.
Bunte, blickfangende „Wegmarken“
Der etwa fünf Kilometer lange Weg ist von 24 bunten Kunstobjekten gesäumt und verbindet zwei Länder und Gemeinden. Und er bringt zwei Orte zusammen, die selbst Kunstwerke sind, Architektonische Kunststücke: die Fondation Beyeler in Riehen und den Vitra Campus in Weil am Rhein. Beide Häuser sind Institutionen der Kunst der Moderne – und bei den Skulpturen am Wegesrand handelt es sich um höchst moderne Werke.
Geschaffen hat sie Tobias Rehberger (geb. 1966), einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart und Professor für Bildhauerei in Frankfurt. „Wegmarken“ nennt er die funktionalen Objekte, die vor knapp zehn Jahren entlang der Route installiert wurden.
Diese verläuft zunächst auf einem Fuß- und Radweg durch die Uferlandschaft der Wiese, wo ein abstraktes Wetterhäuschen, eine wolkenförmige Wetterfahne und mehrere „Bienenhäuser“ zu bewundern sind. Von hier aus ist die erste „Kuckucksuhr“ zu sehen, deren riesiges Zifferblatt die hölzernen Umkleidekabinen des gegenüberliegenden Naturbads Riehen überragt und die exakte Zeit anzeigt.
Eine verkehrsreiche Landstraße, die den Fluss und die Grenze überquert, führt zur zweiten „Kuckucksuhr“. Nach Überquerung der Bahnstrecke zwischen Weil und Lörrach wird die Strecke
etwas steil und beschwerlich, mündet indes in einen fast ebenen und sehr aussichtsreichen Weg durch die Reben. Weitere Sklupturen laden zum Betrachten – oder zum Durchauen ein: Der Blick durch das an einem besonders schönen Aussichtspunkt errichtete „Fernglas“ rückt Basel, Jura, Rheinebene und Vogesen näher. Und der Vitra Campus scheint direkt vor den Füßen zu liegen.
Foto: © Erika Weisser
Skulpturenpark
Kloster Schönthal

Begegnungen im Grünen: Martin Dislers Figurengruppe „Häutung und Tanz“
Im Dialog mit der Natur
„Die Natur ist tonangebend“, sagt Parkgründer John Schmid und fügt hinzu: „Die Kunst soll erwandert werden.“ Das ist ganz ernst zu nehmen: Offene Augen, mindestens zwei Stunden Zeit und gutes Schuhwerk sollten Besucher und Besucherinnen des Skulpturenparks in der idyllischen Juralandschaft am Oberen Hauenstein mitbringen, wenn sie die mittlerweile 36 Stationen umfassende Freiluftausstellung erleben wollen. Da begegnet ein zerzaustes Rotkäppchen im Wald dem Wolf (Nicola Hicks, Foto rechts), Bronzefiguren „tanzen“ mitten
auf der Wiese (Martin Disler, o.). Im Dialog mit der Natur sind die Kunstwerke entstanden, auf Wiesenwegen, über Trampelpfade und knorrige Wanderwege lassen sie sich erkunden.
Los geht’s an der Klosteranlage. An der Kasse sind 15 Franken Eintritt und 2 Franken für einen Faltplan zu bezahlen, auf dem alle Kunstwerke verzeichnet sind. Mindestens zwei Blicke auf die historischen Klostermauern sind erlaubt, denn das Kloster und die romanische Kirche gelten als Prunkstücke der hochromanischen Schweizer Architektur. Das 1145 gegründete Kloster ist das älteste in Baselland, und die 1187 geweihte Kirche ist mit ihren Skulpturen immer noch in gutem Zustand. Seit 1836 ist das Gebäudeensemble in Privatbesitz und seit 1967 steht es unter Denkmalschutz. Allerdings wurde das romanische Juwel als Holzschopf genutzt, bis der Werbefachmann John Schmid das Anwesen Mitte der 1980er-Jahre kaufte. Der amerikanische Lichtkünstler James Turrell brachte ihn auf die Idee, einen Skulpturenpark anzulegen. Viele Renovierungen später, umgeben von einem wachsenden Skulpturenpark, gehört das Kloster Schönthal heute einer Stiftung und wird als spirituelle und kulturelle Begegnungsstätte genutzt.
Überraschende Ein- und Ausblicke
Ulrich Rückriem, Nicola Hicks, Richard Long, Miriam Cahn und 30 weitere internationale und Schweizer Künstler haben hier im Laufe der Jahre Skulpturen geschaffen für die Wiesen und Wälder rund um das Kloster Schönthal. Dabei machen sich die Künstler mit der Geschichte und der Umgebung vertraut. Der britische Gartenkünstler Ian Hamilton Finlay verbrachte 2001 mehrere Junitage in Schönthal und hinterließ Schriftspuren im Christophorusraum des Klosters. Der Schweizer Künstler Not Vital schuf 2013 eine Art überdimensionalen Wanderstab aus Chromstahl, der – gleich zu Beginn der Tour – im Innenhof an einer Dachkante lehnt. Mit Belchenblick ist die gleichnamige Skulptur der Basler Künstlerin Barbara Schnetzler zu genießen, die 2023 Artist in Residence in Schönthal war. Innige Beziehungen zur Natur, ganz individuelle Ausdrucksformen und überraschende Ein- und Ausblicke verspricht die Skulpturen-Tour auf dem rund 100 Hektar großen Areal. Ganz im eigenen Tempo können Besucherinnen und Besucher das faszinierende „work in progress“ erwandern.
Der Skulpturenpark ist das ganze Jahr zugänglich. Ab 1. Mai ist auch die Klosterkirche, in der Ausstellungen stattfinden, wieder geöffnet (Freitag bis Sonntag + Feiertage, 11–18 Uhr). Räumlichkeiten werden für Seminare vermietet und übernachtet wird in schön hergerichteten Zimmern mit komfortablen Betten.
Foto: © Heiner Grieder